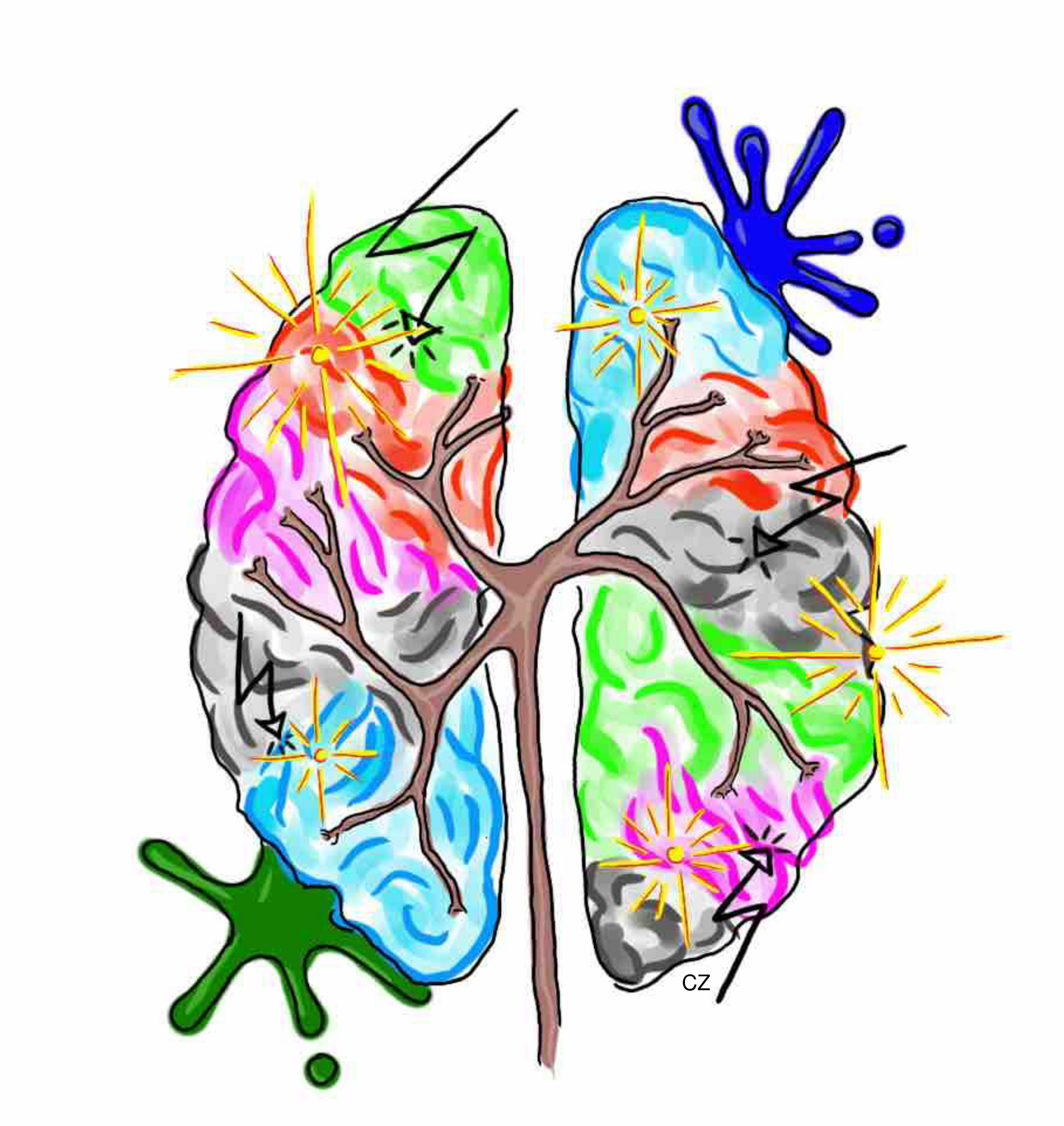Mitglied im
Meine kulturelle Brille
Fabian Weber – B.A. Sozialarbeiter / Sozialpädagoge, M.A. Psychosoziale Beratung in der Sozialen Arbeit, Dozent im Sozialwesen
Multikulturell, Transkultur, Interkultur, Leitkultur sind Begrifflichkeiten, welche mehrere gesellschaftliche Debatten bestimmt haben und weiterhin bestimmen. Diese Themen halten auch Einzug in pädagogischen Einrichtungen. Dabei gestaltet sich das Thema in unterschiedliche Kategorien. Bspw. werden Kitas auf das Thema aufmerksam, wenn sie selbst ein diverses Klientel bekommen, also Kinder und Eltern, welche Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache lernen. Manchmal wird das Thema auch deutlich, wenn sich vermeintlich jahrelange Muster oder Traditionen verändern oder infrage gestellt werden. In diesen Fällen müssen Pädagogen und ihr Umfeld reagieren und sich professionell zur jeweiligen Veränderung verhalten. Dies ist dann zumeist leichter gesagt als getan! Denn was heißt das? Wie viel Veränderung ist verträglich? Was macht mich und meine Kultur aus? Möchte ich eigentlich, dass sich etwas ändert?
Nun, all diese Anliegen müssen Pädagogen für sich klären und dabei eine Haltung entwickeln. Es gibt aber eine Möglichkeit, sich erst einmal der eigenen Kultur bewusst zu werden. Dies ist essentiell, um eine Haltung zu entwickeln und sich einer anderen Kultur zu öffnen. Doch es braucht eine aktive Auseinandersetzung mit den eigenen kulturellen Hintergründen und Selbstverständlichkeiten. Die eigene Kultur ist dabei nichts Abstraktes oder ein Ausstellungsstück im Museum, welches je nach dem immer mal besucht werden kann. Die eigene Kultur findet viel mehr Anwendung im Alltag als wir vielleicht denken. Jeden Tag erwecken wir unsere Kultur in unserem Handeln, in unserer Sprache und in unseren Gedanken. Kultur ist somit mehr als Festivitäten oder Bräuche, es ist wesentlicher Bestandteil unserer Lebenswelt. Dadurch braucht es eine aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Prägungen, um andere kulturelle Perspektiven zu erkennen. So wird eine Basis geschaffen, welche die Grundlage zum weiteren Verständnis schafft. Sie können sich mit drei Fragen einer aktiven Auseinandersetzung mit Ihrer Kultur stellen.
Wie sieht mein Tagesablauf aus?
Der Tagesablauf ist bei vielen Personen einer Kultur zwar leicht unterschiedlich, weist aber in vielen Fällen Gemeinsamkeiten auf. Bspw. ist die tägliche Routine ein wesentlicher Zugang zur eigenen kulturellen Lebensführung. Morgens nach dem Aufstehen wird sich fertig gemacht (Zähneputzen, Duschen, Haare stylen, Schminken, …), dann gefrühstückt, am Vormittag wird einer Tätigkeit nachgegangen, dann zu Mittaggegessen und so weiter. Der Tagesablauf wird natürlich weitergehen und sich in den ein oder anderen Dingen unterscheiden, allerdings braucht es für das menschliche Zusammenleben Überschneidungen im Tagesablauf. Nun können aber bei diesen Überschneidungen auch Diskrepanzen entstehen, wenn mein Tagesablauf von meinem Gegenüber so gestört wird, dass ich diesen verändern muss. Werden Sie sich also bewusst, was Sie tun und warum es für Sie wichtig ist, dann haben Sie die Möglichkeit dies zu kommunizieren oder dem Gegenüber eine ähnliche Frage zu stellen, um ein Verständnis für diese Praktiken zu erlangen.
Welche Werte sind mir im alltäglichen Leben wichtig?
Ja, die Werte Respekt, Höflichkeit, Pünktlichkeit, Fleiß, Toleranz, … (diese Liste könnte hier beliebig erweitert werden), spiegeln sich in unserem Alltag wider und nehmen dabei einen wesentlichen Platz ein. Zumeist wird uns bewusst, dass wir einem Wert nachgehen oder ihn praktizieren, wenn gegen diesen verstoßen wird. Dann reagieren wir sensibel, denn uns fällt auf, dass unser Handeln und unsere Werte nur eine begrenzte Wirkung haben. Damit uns dies nicht aus der Bahn wirft, brauchen wir ein Bewusstsein über unsere Werte. Daher ist es ratsam sich diese zu notieren und zu überlegen, wann diesen im Alltag nachgegangen wird. Durch das Bewusstwerden dieser Angelegenheiten, können diese bei einem selbst besser beobachtet werden und auch hier bei Konflikten bspw. kommuniziert werden. Wertebewusstsein ist das wichtigste Instrument für eine interkulturelle Arbeit.
Was möchte ich weitergeben?
Die Weitergabe von Werten und Tradition ist ein wesentlicher Bestandteil aller Gesellschaften. Auch in den täglichen Interaktionen gibt es den Wunsch, Verhaltensweisen weiterzugeben. Das Bewusstsein über die Werte, welche weitergeben werden sollen bietet eine Grundlage für eine Reflektion. So können wichtige und grundlegende Verhaltensweisen und Traditionen erkannt werden. Diese dürfen auch positiv hervorgehoben werden. Dabei bietet es sich besonders an zu überlegen, was andere Personen von einem lernen sollten bzw. welche Eigenschaften in einer Gemeinschaft wichtig sind und weitergegeben werden sollen. Es kann so auf die eigenen wichtigen Werte geschlossen werden. Dabei muss aber erwähnt werden, dass es hierbei um Klarheit geht und nicht darum, diese Werte jemandem aufzuerlegen. Die Menschen wollen ihre Werte weitergeben und die Klarheit kann zu einem Wertebewusstsein führen, mit welchem wieder neuen kulturellen Standpunkten gegenübergetreten werden kann.
Die Thematik der multikulturellen Perspektive zeichnet sich durch eine starke Komplexität aus, welche stetig reflektiert und bearbeitet werden muss. Die drei obigen Fragen können diese Thematik nicht in Gänze aufarbeiten, bieten allerdings eine Möglichkeit einen längerfristigen Prozess anzustoßen. Damit kann Freude an multikultureller Arbeit gefunden und ein gemeinsames Miteinander entworfen werden.
Seminare der Bildungswerkstatt zum Thema
Multikulturalität:
• Sprachbarrieren – So gelingt Kita-Kindern der Start in die deutsche Sprache am 27.08.2025 oder am 27.11.2025
• Rassismussensibilität im pädagogischen Alltag am 30.09.2025
• Sprache ist das Tor zur Welt–Verständigungsprobleme von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache am 04.12.2025